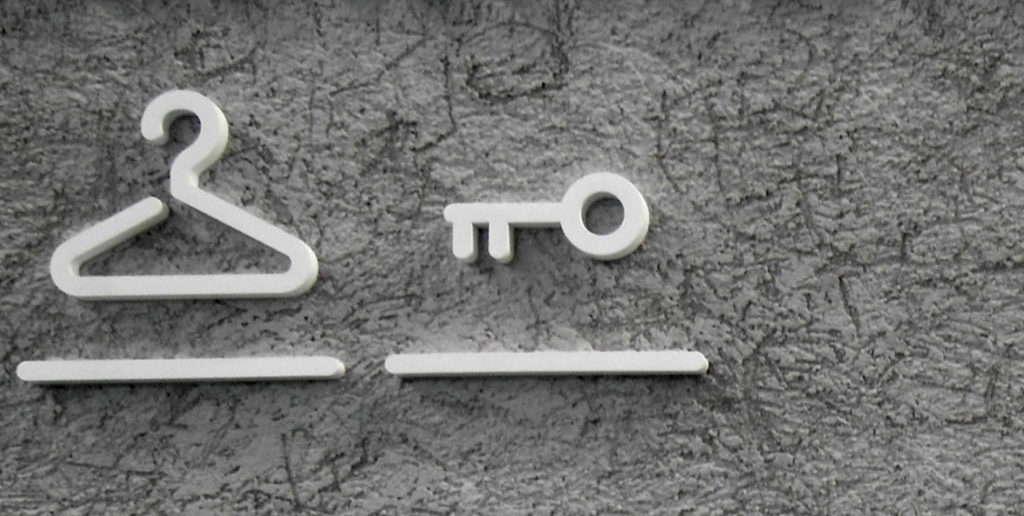Nach der Euphorie, den Lobeshymnen, dem Hype, sind wir in der gebotenen Ruhe und Bedacht an den Ort des Geschehens zurückgekehrt und haben versucht, den Bau von Christ & Gantenbein über die Betrachtung der Details besser zu begreifen.
Was zuerst auffällt, ist die Vielfalt und Differenziertheit der eingesetzten Materialien. Die „Dinghaftigkeit“, welche die Architekten interessiert, lässt sich dabei gut nachvollziehen. Die eher kalt-mineralisch-metallischen Erschliessungsräume treten in Kontrast zu den warm-hellen Ausstellungsräumen. Der Marmor in Kombination mit dem grauen Kratzputz erzeugt eine Stimmung der würdevollen Strenge. Hier drängt sich der Vergleich zum Altbau auf: Auch dort wird Naturstein mit einem deutlich feinkörnigeren Kratzputz kombiniert. Die Stimmung ist dadurch wesentlich freundlicher und entspannter. Der Neubau wirkt in dieser Hinsicht erstaunlicherweise konservativer als der Altbau von Bonatz und Christ.
Ein Zeichen der Gegenwart? Da fallen die Elemente aus feuerverzinkten Stahl, insbesondere die Handläufe und Gittertore zu den Ausstellungsräumen, aber auch die flächigen Platten im Eingangsbereich und den Liftbereichen, ins Auge. Die diffuse Reflektion erzeugt ein Bild der Tiefe und Unschärfe, was dem Raum eine aussergewöhnliche Qualität verleiht. Etwas problematischer sehen wir den Handlauf, wo man den Stahl anfassen muss – keine besonders wohltuende Erfahrung. Das Industrielle, was die Gegenwärtigkeit betonen soll, verkommt in einer post-industriellen Gesellschaft zum artifiziellen Zitat. Genauso können die Betonrippen in den Ausstellungsräumen mit den unprätentiösen Lichtröhren, die für eine etwas gar grell-blendende Werkhallenbeleuchtung sorgen, gelesen werden. Anders die Lichtqualität in den Oblichtsälen: Hier ist das Licht deutlich feiner abgestimmt und weniger blendend. Der Bodenbelag aus gerastertem Eichen-Klebeparkett mit breiten Zement-Holzfugen erzeugt einen starken Kontrast, was je nach Kunstwerk zu einer Spannung oder (im Negativfall) einer visuellen Überreizung führt.
Uns interessieren die Fugen, die Orte der Materialwechsel: Hier wurden die Details sorgfältig entwickelt und ausgeführt. Dennoch fragt man sich beispielsweise, ob zwischen den Ausstellungsräumen eine (visuelle) Schwelle aus Marmor und verputzen Rahmen notwendig ist, um die Räume stärker zu trennen. Hier wünscht man sich insgeheim die Entspanntheit des Altbaus, wo das Parkett zwischen den Ausstellungsräumen durchgehend verlegt wurde. Gelungen ist in unseren Augen die liegende Sockelleiste, die den Übergang zwischen Parkett (Boden) und Putz (Wand) im besten Sinne zu rahmen vermag.
Abschliessend soll gesagt sein, dass man wenige Wochen nach der Eröffnung sicherlich kein definitives Urteil über den Bau fällen kann. Wie beim bestehenden Museumsbau aus den 30er Jahren wird sich weisen, wie die Architektur mit der Kunst und den Besuchern in einen Dialog zu treten vermag. In diesem Sinne freuen wir uns auf anregende Gespräche.