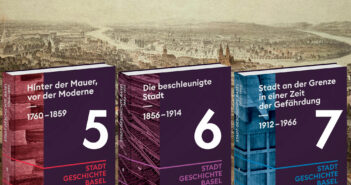Der Baustoff Beton erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Die haptischen und plastischen Qualitäten lassen Architektenherzen höherschlagen. Die Publikation „Made of Beton“ geht dem Phänomen der zeitgenössischen Schweizer Betonarchitektur nach. Das im Basler Birkhäuser-Verlag erschienene Buch diskutiert anhand von 16 Projekten den architektonischen Umgang mit dem Baustoff Beton.

Systematische Ordnung der analysierten Bauten © Birkhäuser Verlag, Basel
Wir beginnen in Basel. Hier liegt der Ursprung der Schweizer Betonarchitektur. Mit dem Bau der Antoniuskirche, der ersten reinen Betonkirche in der Schweiz, gelang Karl Moser 1927 ein wegweisender Beitrag zum damals vergleichsweise unerprobten Umgang mit Beton als Gestaltungsmaterial. Im selben Atemzug kann das zweite Goetheanum in Dornach (1925- 28) als eines der bedeutendsten Monumente der Schweizer Betonarchitektur genannt werden. Es veranschaulicht auf besonders eindrückliche Art und Weise die plastischen Qualitäten des Baustoffs. Damals gab es starke ästhetische Bedenken gegenüber dem Beton. Die Antoniuskirche wurde abschätzig als „Seelensilo“ bezeichnet.

Wohnhaus Schwarzpark von Miller & Maranta © Birkhäuser Verlag, Basel
Zurück in die Gegenwart: Es ist insbesondere Basler Architekturbüros, wie Miller & Maranta oder Buchner Bründler zu verdanken, dass „Betonarchitektur aus der Schweiz Weltruf“ hat – wie die beiden Herausgeber Daniel Mettler und Daniel Studer ohne falsche Bescheidenheit auf dem Umschlag verkünden. Ihre Herangehensweise ist systematisch, wissenschaftlich. Die 16 Projekte werden nach Tragwerkprinzip und Schichtaufbau der Gebäudehülle geordnet. Ein praktischer Einstieg für alle Bauchfachleute, die nach einer konstruktiven Lösung ihrer Betonarchitektur suchen. Die Projekte werden stets auf ein bzw. zwei Doppelseiten mit einem knappen Beschrieb und einer Auswahl an Fotos vom Bauprozess und dem fertigen Objekt vorgestellt.
Danach geht es ans Eingemachte: Die Bauten werden mit sehenswerten, axonometrischen Konstruktionszeichnungen wortwörtlich in die Einzelteile zerlegt. Die Zeichnungen sind – abgesehen von ihrer hohen ästhetischen Qualität – unter anderem deshalb bemerkenswert, weil sie dank der versetzten Schnittebene den Bauprozess beispielsweise in Form der Betonschalung abbilden. Der Massstab ist einheitlich 1:10 und 1:1. Das vereinfacht die Les- und Vergleichbarkeit. Trotz aller Liebe fürs Detail lassen den Betrachter die 1:1-Detailzeichnungen teilweise etwas ratlos zurück, eine Orgie von Blechverkleidungen, Wetterschenkeln, Kittfugen und Abdichtungsfolien. Hier fühlen sich eher Fensterbauer angesprochen als Architekten. Dennoch ist es den Autoren hoch anzurechnen, mit welcher Akribie die verschiedenen Betonkonstruktionen analysiert und gezeichnet wurden.

Bis zur letzten Schraube: Eindrückliche Detailzeichnung vom Schwarzpark © Birkhäuser Verlag, Basel
Auf die konstruktive Analyse der Betonbauten folgt die theoretische Annäherung in Form von vier Textbeiträgen. Als Auftakt suchen Daniel Mettler und Daniel Studer in den analysierten Sichtbetonbauten die Systematik im Umgang mit dem Baustoff Beton. Sie stellen einerseits ein „Verschmelzen von Tragstruktur und Hülle durch den Verzicht auf bauteiltrennende Wärmedämmschichten“ und anderseits eine Trennung von Innen- und Aussenteilen „dank der Verdoppelung der Schalen“ fest. Geschichtsprofessor Philipp Sarasin geht dem „Spiel der Oberfläche“ des Sichtbetons nach. Er konstatiert das landläufige Vorurteil, dass Beton „hässlich“ sei. Den Grund sieht Sarasin in der profitorientierten Betonarchitektur der Hochkonjunktur in den 1960er-Jahren, die von vielen als Synonym für ein kaltes System empfunden wurde. In den Augen von Sarasin beweisen die im Buch gezeigten Projekte, dass die Verwendung von Beton „in keiner Weise zwingend als „Betonarchitektur“ erscheinen muss.“
Einen anderen, lustvollen Zugang wählt Autor Caspar Schärer: Er schreibt dem Baustoff Beton eine Art Liebesbrief. „Gerade an einem heissen Sommertag ist es erfrischend, in der aufgeheizten Stadt an einer Baustelle vorbeizuziehen auf der gerade betoniert wird.“ Der Text ist klug, humorvoll und endet augenzwinkernd: „Und so ist jede Sichtbetonwand ein kleines Stück Alpen und ein Bekenntnis zur Schweiz.“ Der Textbeitrag von Bauingenieur Mario Rinke geht wesentlich analytischer und kopflastiger an die Sache heran. Er erklärt die Funktionsweise des hybriden Materials Stahlbeton und zeigt die „tragstrukturellen Wirksamkeiten im Inneren und Äusseren“ auf. Der Beitrag verdeutlicht, dass der Umgang mit „modellierte Materialmasse“ des Betons für den Bauingenieur von ebenso grosser Bedeutung ist, wie für den Architekten.

Grundrisse, Ansichten und Schnitte im Massstab 1:1000 © Birkhäuser Verlag, Basel
Der Schlussteil gehört dann wieder ganz den vorgestellten Projekten. Im einheitlichen Massstab 1:1000 werden sie in Form von Grundrissen, Schnitten und Ansichten dokumentiert. Bei den kleineren Projekten wie dem Refugi Lieptgas in Flims verkommen die Pläne dabei leider zu einem Fall für die Lupe. Der Massstab hätte in diesem Teil variabel gewählt werden sollen. Im Appendix finden sich schliesslich alle Planlegenden. Hier kann der exakte konstruktive Aufbau (beispielsweise die Dichte des Betons) nachgeschlagen werden. Etwas praktischer wäre es gewesen, die Legenden unmittelbar neben den Konstruktionszeichnungen anzuordnen. Darunter hätte jedoch die grafische Ästhetik gelitten. Und so blättert der Lesende etwas öfter als üblich die Seiten. Da diese aus haptisch ansprechendem Grenita-Papier sind, ist das jedoch nicht unangenehm.
Das Buch richtet sich in erster Linie an Fachleute aus Architektur und Ingenieurwesen, wobei löblicherweise viel Wert auf die Gestaltung gelegt wurde. Konsequent in Schwarzweiss und mit viel Liebe fürs grafische Detail kommt das Buch visuell äusserst ansprechend und stimmig daher. Als grafische Werke sind die Zeichnungen auch für Laien sehenswert. Und was bekommt der Basler Architekturfan geboten? Einerseits drei zeitgenössische Betonbauten aus Basler Feder von Miller & Maranta, Christ & Gantenbein, Buchner Bründler Architekten und ausserdem eine besonders akribische konstruktive Analyse des Wohnhauses am Schwarzpark der erstgenannten Architekten – sowie den Beweis, dass Betonarchitektur in Basel auch neunzig Jahre nach Fertigstellung der Antoniuskirche und des Goetheanums nach wie vor von grosser baukultureller Bedeutung ist. Stahlbeton sei „das schönste Konstruktionssystem, das die Menschheit bis heute je hat finden können“, meinte der italienische Ingenieur Pier Luigi Nervi einst. Nach der Lektüre von „Made of Beton“ ist man geneigt ihm beizupflichten.
Text: Lukas Gruntz / Architektur Basel
 Hrsg. v. Mettler, Daniel / Studer, Daniel
Hrsg. v. Mettler, Daniel / Studer, Daniel
Made of Beton
2018 Birkhäuser Verlag. 32,0 x 28,0 cm, 144 Seiten, 18 Abbildungen, Deutsch und Englisch
CHF 69.90 / € [D] 49.95
ISBN 978-3-7965-1742-6